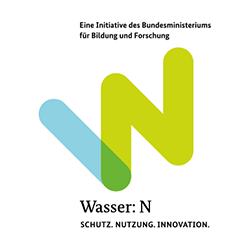Eine Stahlproduktion und Weiterverarbeitung ist ohne ausreichende Wasserressourcen nicht denkbar. Die globale Verknappung der Wasserverfügbarkeit in ausreichender Qualität und Menge hat inzwischen auch vermeintlich wasser-sichere Regionen wie Deutschland erreicht. Diese Tatsache war die Triebfeder des Projektes WEISS_4PN, welches sich mit verschiedenen Facetten zur Senkung des Frischwasserverbrauchs von Stahlstandorten beschäftigt hat.
Nach Analyse von verschiedenen Ab(salz)wässern des Industriekomplexes von ArcelorMittal in Eisenhüttenstadt wurden geeignete Abwässer für die Pilotierung ausgewählt und ein Verfahrenskonzept entwickelt. Die Umsetzung der Konzeptes und der Versuche an der zentralen Abwasseranlage, im Bereich der Stranggussproduktion als auch am Warmwalzwerk wurden erfolgreich durchgeführt, teils an einem weiteren Stahlstandort erneut durchgeführt und die Ergebnisse konnten reproduziert werden.
Im Ergebnis konnten über die Vorbehandlung und den Umkehrosmosestufen Gesamtausbeuten von 95% der Wasserrückgewinnung mit hochwertigen Permeaten erzielt werden, die je nach Rahmenparameter des Standortes zu einer Frischwassereinsparung von 30-70% führen können. Über die Versuche der alternativen Entsalzungstechnik der membrangestützten Kapazitiven Deionisation (mCDI) konnten Rückgewinnungsqualitäten dargestellt werden, die ebenso innerhalb der betrieblichen Vorgaben für Frischwässer liegen – zudem zeigten sich bei speziellen Inhaltsstoffen gute Trennleistungen die im Gesamtkonzept sehr nützlich sind. Die Labor- und Pilotierungsversuche der Anti-Fouling-Beschichtung, die aufgebracht auf Umkehrosmosemembranen die Fouling-Neigung der Membranen herabsetzt, erwiesen sich als vielversprechend und praxistauglich.
Die Versuche der selektiven Niedertemperatur Destillation Kristallisation (sNDK) fanden ausschließlich im Technikums-Maßstab statt. Hier konnten nach der Verdampfung einer synthetischen Salz-Mischlösung mittels einer kontrollierten selektiven Kristallisation die Salze in ausreichender technischer Reinheit aufgetrennt werden. Die realen Konzentrate der Walzwerks-Absalzwässer konnten zwar verdampft werden, eine selektive Kristallisation war auf Grund des hohen Organikgehaltes jedoch nicht möglich, zur Zielerreichung hier muss zunächst vor der Verdamfpung eine Organikabtrennung vorgenommen werden.
Eine ganz andere Facette der Frischwasserreduzierung lässt sich über ein Digitales Kühlwassermanagement darstellen. So wurde das weit vernetzte Wasserwirtschaftssystem des Industriepartners über eine Simulationssoftware abgebildet, über die nun externe Wasserverfügbarkeitsdaten eingespeist werden können, um zukünftige Engpässe vorzeitig zu erkennen (in diesem Falle Flusspegelstände). Auf der anderen Seite wurden Wege gesucht, wie der schwankende Wasserbedarf einer Produktionsanlage in Abhängigkeit der geplanten Produktion und Parametern der Wasseraufbereitung vorausberechnet werden kann. Im Zusammenspiel von Wasserbedarf und Wasserverfügbarkeit liegen einem Stahlproduzenten somit Daten für eine wasser-effiziente Produktionsplanung vor.


Die Wirtschaftlichkeit von Wasserrückgewinnungsanlagen bis zum ZLD-Prozess können aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden. Einerseits kann Wasser zurückgewonnen werden, um aus wirtschaftlicher Sicht Frischwasser einzusparen, zum anderen können so Wasserressourcen erschlossen werden um die Verfügbarkeit zu erhöhen. Auf der anderen Seite können Einleitbedingungen umgangen werden, indem Salzfrachten als Feststoff entsorgt werden. Die in der Realität erreichbaren Einsparpotentiale sind stark von den lokalen Gegebenheiten abhängig. Beispielsweise liegt die Leitfähigkeit des Frischwassers eines alpinen Stahlstandortes bei <100 µS/m, wohingegen ggf. Oberflächengewässer des Tieflandes, stromabwärts von Bergbau- oder Industrieregionen Leitfähigkeiten von durchschnittlich 800 µS/m, in extremen sommerlichen Hitzeperioden in der Spitze auch > 2000 µS/m erreichen können. Im alpinen Fall rechnet sich Wasserrückgewinnungsanlage in der Regel nicht, allerdings kann diese ggf. überhaupt erst eine Produktion sichern, sobald es zu Wasserengpässen kommt. Wohingegen im 2. Fall bei einem ZDL-Prozess eine Frischwassereinsparung von 50% dargestellt werden kann, die sich in der Sommerperiode bis über 80% steigern kann.
Das Projekt WEISS_4PN zeigt auf jeden Fall viele Chancen zur Frischwasserreduzierung der Stahlindustrie auf.